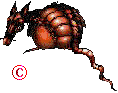Besonders in der (vor-)babylonischen Kultur machte man sich intensive Gedanken zu dem Umstand, dass es auf Erden keinen Unterschied bezüglich des Schicksals der guten und der bösen Menschen zu geben scheint. Oft fanden sich die Bösen im Genuss des besten Lebens, während die Guten Not litten. Auch auf Dauer gesehen änderte sich nicht zwingend etwas an dieser irdischen Ungerechtigkeit, so dass der Luxus des Bösen in einem langen fröhlichen Leben anhielt, während die Not des Guten sich nicht linderte bis zu seinem Tod.
| Es lässt sich auf Erden keine Regel erkennen, nach der sich die Hingabe zu einem Gott bezahlt machen könnte: Dem Gottesfürchtigen ergeht es nicht besser als dem Gottlosen. |
Aus diesem Umstand resultierten Überlegungen wie folgt:
- Ein Mensch könnte nicht erkennen, ob dieser scheinbar Gute, Notleidende auch tatsächlich gut war. Dessen Not konnte womöglich deutlich machen, dass damit die weise und weitsichtige Gottheit die der menschlichen Betrachtung verborgene Bosheit des Notleidenden straft. Dies bot natürlich eine äußerst bequeme Gelegenheit, jeden Notleidenden zu verleumden und ihm verborgene Schlechtigkeiten anzudichten.
- Jeder Mensch sei von Grund auf böse. Da auf Erden jeder "sein Päckchen zu tragen" hat, sei dies nur das beste Zeichen, dass der Mensch von Geburt an irgendetwas Schlechtes an sich hat, was er dadurch abzutragen hat oder von dem er sich zu reinigen hat. Hiermit ist dann auch gleich die Frage nach dem "Sinn des Lebens" erschlagen.

- Später kam dann die Idee auf, dass der Notleidende für die Sünden anderer von Gottes Zorn getroffen wird, beispielsweise für die Schlechtigkeit seines Volkes, seiner Sippe, seiner Vorfahren. In der "Erbsünde" findet diese Vorstellung noch heute ihren Fortsetzung.
- Auch betrachtete man die Not - so lange sie nicht im Tod mündete - als eine Lektion der Gottheit, die diese nur ihrem Günstling gewährte, um ihn zu fördern - eine Art antikes "was uns nicht umbringt, macht uns nur härter".
- Es mag der Lohn eines Gottes erst in einem Leben jenseits des Irdischen eintreffen. Diese Vorstellung setzte sich allerdings erst durch, nachdem man an ein Leben nach dem Tod überhaupt glaubte.
Der Sinn des Lebens
- Dabei ist es doch so simpel und einfach - wenn man sich selbst nicht immer so schrecklich wichtig nähme und wenn man nicht in allem einen "höheren Sinn" sehen wollte.


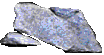 Das Leben ist einfach ein Weg, vergleichbar mit einem Berg, von dessen Spitze ein Stein nach unten rollt.
Das Leben ist einfach ein Weg, vergleichbar mit einem Berg, von dessen Spitze ein Stein nach unten rollt.